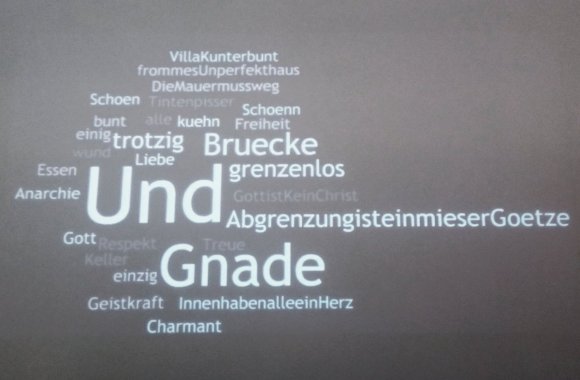Wenn ich etwas bei Emergent zu schätzen gelernt habe, dann ist es die Erlaubnis nachzudenken, weiterzudenken und anders zu denken. Besonders dort, wo Menschen sehr persönlich über ihren Glauben reden, will man in der Regel eigentlich nicht zu viele kritische Rückfragen stellen. Aber gab es bei dem Forum zum Glück genügend Räume für solche Rückfragen, die die Chance eröffneten Positionen argumentativ zu unterlegen.
Nun ist Nachdenken etwas, was ich gut kann – den Dingen nach-zudenken. Und nachdenkenswert fand ich das Forum. Es beschäftigt mich auf einer persönlichen Ebene und einer intellektuellen Ebene. Deshalb meine Resonanzen auf einige der starke Sätze, die mir hängen geblieben sind. Dies sind auch weiterführende Gedanken zu dem, was Jaana an anderer Stelle angemerkt hat.
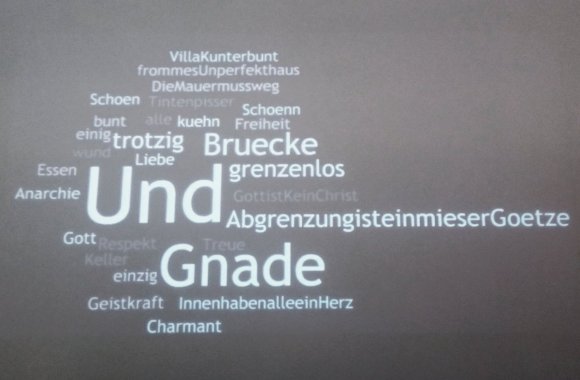
“Ich will das ‘und’ sein, nicht das ‘aber'” – Gesprächskultur
Das Verbindende suchen, nicht das Trennende, den Konsens, nicht den Dissens, die Horizonterweiterung, nicht die Selbstgettoisierung. Das wären drei – übrigens sehr unterschiedliche – Formulierungen wie man den Satz verstehen kann vom “und” und dem “aber”. Nun war der Satz eher auf das Gottesbild und die daraus resultierende Praxis gemünzt. Ich will ihn erst einmal für die Gesprächskultur auf dem Forum untersuchen. Denn bestenfalls kann der Satz meinen: lernen, sich angstfrei einer Pluralität von Ansichten auszusetzen und sich herausfordern lassen, aber auch angstfrei und ohne übermäßige Selbstzensur selbst in Erscheinung zu treten (“Zeuge zu sein”). Schlechtestenfalls hieße das: Harmoniesucht, Unterdrückung von Streit, Unterstellung einer großen Gemeinsamkeit, die gar nicht vorhanden ist und das Ausblenden aller skeptischen Rückfragen. Nochmals: Christina wollte explizit nicht so verstanden werden, aber ich möchte dennoch mal in die Richtung etwas sagen, weil man eine bestimmte Tendenz immer wieder sieht: Gerade “bei Kirchens” begegnet einem manchmal das, was Nietzsche etwas bissig “die Unfähigkeit zur Feindschaft” nannte. Man könnte wohl eher übermäßiger Konfliktscheu und Harmoniesucht reden. Der Unfähigkeit Dinge an anderen Scheiße zu finden, die Unfähigkeit einen unbequemen Standpunkt zu vertreten, der gerade im Raum keine Mehrheiten findet.
Dort, wo Gespräche geführt werden, passieren verschiedene wunderbare und weniger wunderbare Dinge. Eines davon kann man mit Miroslav Volf “Differenzierung” nennen*: das so genannte “Eigene” bildet sich in der Auseinander-Setzung mit andern und der Abgrenzung von anderen. Immer. Da, wo Menschen auf leidenschaftliche Weise zu etwas “JA” sagen, müssen sie zu anderem “Nein” sagen. Seit Jahren leben wir in einer Kultur, die diese Art von Differenzierung nicht gerade fördert weil sie im Streit etwas Bedrohliches sieht. Ich bin mehr und mehr der Überzeugung: die eigentliche Bedrohung heute ist die Unfähigkeit, sich auf menschliche Weise miteinander – auseinander zu setzen. Die Unfähigkeit zum fairen und höflichen Streit.
Neben der Differenzierung spricht Miroslav Volf auch vom “judging”. Judging bedeutet nicht die Verurteilung anderer, sondern bezeichnet den Einsatz der kritischen Urteilskraft um eine Position (auch seine eigene zu befragen). Gerade dieser Aspekt wird manchmal nicht gern gesehen, da er zu oft mit Rechthaberei, Besserwisserei und anderen Charakterschwächen einher gegangen ist. Außerdem gibt es eine starke Bewegung in der “spirituellen Szene”, die das Ausblenden der kritischen Urteilskraft betont. Wir brauchen aber heute mehr denn je Menschen die “fähig sind, sich ihres Verstandes zu bedienen” und die verschiedene Positionen auch kritisch bewerten können NACHDEM sie diese verstanden haben. Nicht ein zuviel, sondern ein zuwenig an kritischer Urteilskraft führt zu falschen Verasbolutierungen der eigenen Comfort-Zone.
Für Christen könnte ein Leitbild dabei die “Feindschaft gegen die Feindschaft” sein. Also durchaus ein Kampf und ein Streit gegen “Exklusion” – gegen die Entmenschlichungs des Andersdenkenden, des moralisch Fragwürdigen oder des Feindes. Gerade dabei wird es aber leider nicht immer ohne schmerzhafte Trennungen ablaufen. Denn es gibt Dilemma Situationen, in denen Solidarität mit dem einen zur Feindschaft mit dem anderen führen kann. In diesen Dilemma-Situationen wird dann die Beziehung zu anderen anspruchsvoll. In jedem Eingehen auf andere blendet man “andere andere” aus. Dem einen zuzuhören heißt andere zu überhören. Und hier haben wir den Salat: auf der einen Seite betonen wir mit großem Recht die Selbstzurücknahme und den Machtverzicht als Leitbild, welches sich aus dem Kreuzesgeschehen heraus ergibt. Auf der anderen Seite haben wir schon in den basalsten Gesprächen mit Machtfragen zu tun: wem höre ich zu, wer darf sprechen, wessen Stimme zählt? Da, wo Menschen, “einfach nur auf Augenhöhe” miteinander sprechen gibt es immer andere Stimmen, die mehr oder weniger bewusst überhört werden.
ABER – und hier kommt das Forum ins Spiel – wie schlimm wäre es, wenn alles immer Streit, immer alles Auseinandersetzung wäre? Wie schlimm wäre es, wenn jeder bockig in seinem Weltanschauungs-Getto oder dem eigenen Safe Space verbleiben müsste? Wir sind keine Gefangene unserer Ansichten und es braucht Orte, in denen man seine eigenen Ansichten mal einklammern kann, um wirklich auf andere zu hören – Philosophen sprechen von der Suspendierung (dem Einklammern von dem, was man zu wissen meint). Ich bin froh, dass man beides haben konnte: im persönlichen Gespräch überwog der Versuch, einander zuzuhören und “Raum zu gewähren”. Aber es gab auch – nicht zuletzt auf den Podien – genügend Kontroverse. Ich will beides haben! Den Widerstreit und das aufeinander Hören.
“Warum Biographie IMMER stärker ist als Theologie”
Etwas, was ich im freikirchlichen Bereich immer wieder beobachte: eine Allergie gegen Theologie. Eine Reaktion gegen rigiden Dogmatismus, die sehr verständlich ist. Theologen gelten für viele als Bedenkenträger, die einen sagen, was man nicht tun, denken, sagen darf. Aber Theologie ist doch nicht einfach die Wissenschaft, die wahre Sätze verwaltet. Theologie ist das kritische Durchdenken des eigenen Glaubens, der Dialog mit dem, was bisher über den Glauben gedacht wurde und der Versuch, den Glauben vor dem Forum der Vernunft in seiner Eigenlogik zur Darstellung bringen. Insofern ist Theologie nie ohne Biographie und eine gläubige Biographie nie ohne Theologie. Sowohl Nadia als auch Christina haben doch immer wieder betont, wie ihnen Theologie eine Sprache, eine Grammatik gab. Nadia betonte zudem, wie ihr eine bestimmte lutherische Theologie dabei half die “Freiheit eines Christenmenschen” zu verstehen. Theologie ist meines Erachtens eine Fürsprecherin der Freiheit des Menschen und eine Wissenschaft, die den Menschen befähigen soll mit eigener Stimme über den Glauben zu sprechen und den Glauben aus der Enge und Verkrampfung herauszuführen. Das sie das nicht immer gut gemacht hat sei zugestanden. Doch dann handelt es sich um eine schlechte Theologie.
Selbst bei hochgebildeten Menschen, (vor allem aus einem freikirchlichen Spektrum?), erlebe ich immer wieder eine beharrliche Weigerung sich denkerisch mit dem eigenen Glauben zu beschäftigen, ihn selbst zu verantworten und kritisch zu durchdenken. Irgendwie gibt es die unausgesprochene Prämisse: die Sache mit dem Glauben müsse doch letztlich “ganz einfach” und intuitiv vonstatten gehen. Doch scheint der Glauben eine Tendenz zu haben, eng und bedrückend zu werden, wenn er sich nicht dem kritischen Gespräch stellt. Denn zu schnell unterwirft man sich bereitwillig religiösen Autoritäten und bleibt in (selbst-)zerstörerischen Denkmustern gefangen. Vielleicht ist es an der Zeit, wieder ein positives Verhältnis zur Theologie zu gewinnen und zu sehen, wie die meisten der eigenen Fragen, auch in 2000 Jahren Kirchengeschichte schon einmal gestellt worden. Das Gegengift gegen eine schlechte, rechthaberische, beengende Theologie ist nicht der Verzicht auf Theologie, sondern eine lustvolle und befreiende Theologie.
“In der Begegnung mit anderen sollte vielleicht nicht die Wahrheit, sondern die Liebe zählen”
Wahrheit oder Liebe? Dabei handelt es sich um eine schlechte Alternative. Denn so formuliert bliebe nur eine unwahre Liebe oder eine lieblose Wahrheit.
Vielleicht ist das unablässige Stellen der Wahrheitsfrage heute auch etwas Subversives. Georg Pazderski von der AfD sagte neulich:
“Es geht nicht nur um die reine Statistik, sondern es geht darum, wie das der Bürger empfindet. Perception is reality. Das heißt: Das, was man fühlt, ist auch Realität.”
Das Ausblenden der Wahrheitsfrage ist etwas Gefährliches. Denn, wenn man sich auf “gefühlte Wahrheiten” bezieht und die Frage nach der Geltung dieser gefühlten Wahrheiten ausblendet, so hat man doch trotzdem noch seine starken Geltungsansprüche, wie zum Beispiele: “Wir sollten keine weiteren Flüchtlinge aufnehmen”. Nur, im Ausblenden der Wahrheitsfrage entzieht man diese Geltungsansprüche der kritischen Diskussion. Die Wahrheitsfrage stellen heißt doch, sich einem kritischen Gespräch auszusetzen. Das hat Ingolf Dalferth schöner ausgedrückt, als ich das tun könnte. Für ihn geht es heute nicht um die Frage nach der “Zukunft der Religion in einer säkularen Zeit”, sondern um die “Wahrheit menschlichen Lebens”:
“Die Wahrheit des menschlichen Lebens. Das ist die Frage, um die gestritten wird und gestritten werden muss, nicht das Für und Wider von Religion oder Nichtreligion in einer säkularen Welt. Wie müssten wir leben, um wirklich menschlich zu leben? Wie können wir es? Worauf müssten wir achten, um uns nicht mit weniger zufrieden zu geben, als wir sein könnten? Woran sollten wir uns orientieren, um uns nicht selbst zu täuschen? Und wie können wir es im Miteinander mit anderen, die das genuin Menschliche eines menschlichen Lebens selten genau so verstehen wie wir?”
(Ingolf Dalferth, Transzendenz und säkulare Welt. Lebensorientierung in letzter Gegenwart, Tübingen 2015, S. 43)
Ich finde diese Formulierung sehr gut. Das zeigt: bei der “Wahrheit menschlichen Lebens” geht es nicht einfach nur um ein Set von Überzeugungen und “wahren Sätzen” auch wenn diese nicht fehlen werden. Es geht um nichts, was ich verteidigen müsste, als würde es mir gehören oder über das ich Kontrolle besitze. Vielmehr ist und bleibt sie jeweils außerhalb meiner selbst, so dass ich sie – wieder nur – bezeugen kann.
Dalferth beschreibt dies so:
“die Wahrheit des Lebens, also die Frage nach dem, was ein menschliches Leben – jedes einzelne menschliche Leben auf je seine Weise – trotz aller Dürftigkeit, Unzulänglichkeit, Beschädigung, Falschheit und Verworrenheit wahr und gut und recht macht.” (Dalferth, Transzendenz, S. 44)
Daran sieht man: Wahrheit, dass heißt im Christentum doch nie bloß Fakten und wahre Sätze. Bloße Richtigkeit und Faktizität wäre zu wenig. Das hat das Christentum mit dem Marxismus und der Psychoanalyse gemein: es geht um einen “engagierten Wahrheitsbegriff”: Wahrheit als solche ist nur Wahrheit, wenn sie “frei macht”. Wahrheit kann und darf gar nicht “absolut” sein: losgelöst und über den Köpfen der Menschen schwebend. Doch ist Wahrheit auch kein Besitz, sie wider-fährt mir: sie durchbricht meine liebgewonnen Denkgewohnheiten und fordert mich heraus. Man braucht etwas, dass der eigenen Verworrenheit und der beständigen Tendenz zur Selbsttäuschung widersteht, um “in Freiheit lieben” zu können. Und diese Wahrheit kann mir jeweils nur von anderen gesagt werden. Ich kann auf die Wahrheit nicht einfach zugreifen wie auf ein Bankkonto. So verstanden müsste man hier keine Alternative aufmachen zwischen “Wahrheit” und “Liebe”.
Soviel mal zu einigen Reaktionen auf Soundbites vom Forum. Wenn Zeit ist, werde ich mich die Tage nochmal zu einem Aspekt melden, der immer wieder vorkam: der Versuch, offen zu sein und die Unumgänglichkeit von Exklusionen. Aber das ist ja jetzt schon sehr viel gewesen.
*Diese Gedanken findet man gut entfaltet in Miroslav Volfs Buch “Von der Ausgrenzung zur Umarmung. Versöhnendes Handeln als Ausdruck christlicher Identität, Marburg 2012, S. 76-81.
 Jetzt ist es schon wieder zwei Monate her, dass ich das letzte Mal zum Thema des Pluralismus geschrieben habe. Doch gab es einige andere dringende Schreibarbeiten, die Priorität hatten. Nun also: wie gehen wir damit um, dass die politische Leidenschaften gerade zu explodieren scheint?
Jetzt ist es schon wieder zwei Monate her, dass ich das letzte Mal zum Thema des Pluralismus geschrieben habe. Doch gab es einige andere dringende Schreibarbeiten, die Priorität hatten. Nun also: wie gehen wir damit um, dass die politische Leidenschaften gerade zu explodieren scheint?